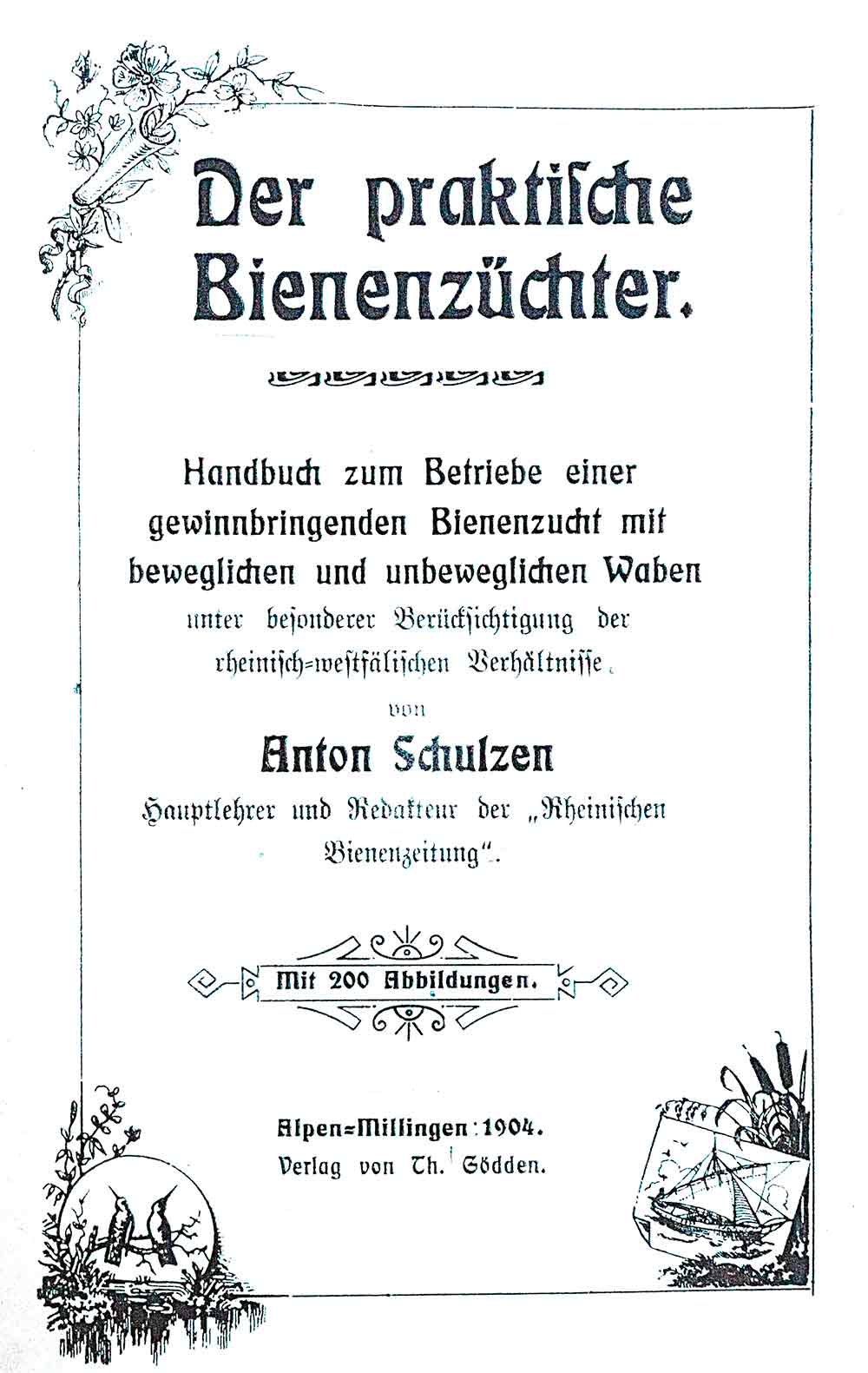Ein Höhenpunkt der frühen Vereinsgeschichte ist die Generalversammlung des Rheinisch-Westfälischen Vereins für Bienen- und Seidenzucht, die vom 30. September – 02. Oktober 1894 in Grevenbroich stattfindet. Gefeiert werden soll im Rahmen dieser Versammlung ein Doppeljubiläum: das 25jährige Amtsjubiläum des Präsidenten Sternberg aus Velbert und das des Schriftführers van Brakel.
Überschattet wird die Versammlung, die in einigen Berichten als turbulent bezeichnet wird, von den Vorwehen einer eventuell bevorstehenden Neuwahl des Präsidenten. Sternberg kann aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen. Statt einer Würdigung seiner langjährigen Arbeit für den Verein gibt es harsche Kritik an seinem Führungsstil und an den Entwicklungen der letzten Jahre. 1888/89 ist es auf Initiative der westfälischen Imker zur Spaltung des Rheinisch-Westfälischen Vereins in einen rheinischen und einen westfälischen Verein gekommen. Im Jahr 1894 gibt es nun viele Vereinsmitglieder, die die Zeit seit 1888 als die sieben mageren Jahre der Verbandsgeschichte empfinden, als eine Art Winterschlaf, während man in beschaulicher Ruhe vom eigenen Fett lebt. Und die Hauptverantwortung wird, wie so oft im Verbandswesen, nicht dem eigenen Untätigsein, sondern dem Weisel, d.h. Sternberg zugeschrieben.
Einige Kritiker haben sich später, insbesondere nach dem Tod Sternbergs einige Wochen nach der Versammlung, für ihren Ton entschuldigt. Auf einer Sondersitzung des Vorstands im Dezember 1894 in Köln wird der junge, kaum bekannte Carl Schneider aus Mayen zum neuen Präsidenten gewählt. Die für viele überraschende Wahl Schneiders ist ein kühnes Husarenstück, bei dem Anton Schulzen nicht unbeteiligt war.
Auf der Generalversammlung werden von bedeutenden Züchtern Vorträge aus Theorie und Praxis der Bienen- und 1894 letztmalig auch der Seidenzucht gehalten. Die Teilnehmer erhalten nicht nur einen Einblick in die neuesten Erkenntnisse einer rationellen Bienenzucht. Es werden Freundschaften geschlossen und es wird auch viel diskutiert.
Bei einer zeitgleich durchgeführten viel gelobten Ausstellung gibt es alles rund um das Thema Bienen- und Seidenzucht zu sehen. Lebende Seidenraupen, ihre Kokons und deren Verarbeitung werden gezeigt, Bienenvölkern und Königinnen können in gläsernen Schaukästen beobachtet werden. Sämtliches Imkereizubehör und alle Produkte aus dem Bienenvolk werden ausgestellt. Neue und außergewöhnliche Produkte und Erfindungen werden mit Prämien, Diplomen und Ehrenpreisen ausgezeichnet.
Für Unterhaltung sorgen diverse Konzerte und eine große Verlosung.